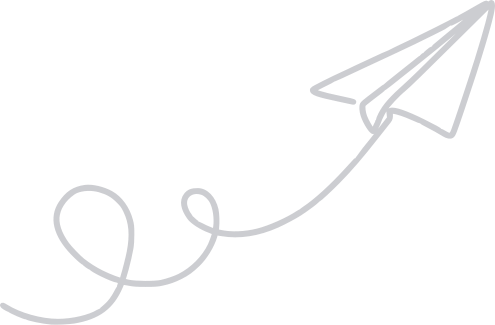Henneckenrode und sein Schloss
Silke, unsere Nachbarin sagt über Henneckenrode:
Henneckenrode ist das schönste Dorf Niedersachens. Mindestens. Es liegt im atemberaubenden Nettetal mit Störchen, Bibern und viel unberührter Natur. In der Nette haben alle Kinder Henneckenrodes Schwimmen gelernt - diese Tradition werden eure dann fortsetzen. Der Sternenhimmel über Henneckenrode ist unfassbar und wenn Vollmond ist, kann ich im Garten Zeitung lesen. Im Henneckenroder Wald kann man in einer Stunde so viele Pilze sammeln, dass eine Familie satt wird. Und die alten Sorten im Obstgarten sind ein Gedicht. Wenn die Schlehen blühen, liegt über Henneckenrode der Zauber des Frühlings und die Lindenblüte raubt einem fast den Atem, so duftgeschwängert ist das Dorf. Die Josefskirche wacht schon so lange im Schlosshof, dass man die Geborgenheit in jedem Stein spüren kann. Henneckenrode ist ein Ort, an dem der Alltag von einem abperlt, und zwar genau dann, wenn man durch die Birkenallee auf das Dorf zufährt.
Überblick über die Geschichte des Schlosses
Deutlich sichtbar ist das Schloss in Henneckenrode der zentrale Ort des Dorfes. Die Eigentümer des Schlosses haben im Wesentlichen die Entwicklung des Ortes bestimmt.
Im Schloss und am Schloss (Gutshof und Dorf) sind vier größere Neubau- oder Umbauphasen zu erkennen: Die Renaissancezeit, die Barockzeit, das 19. Jahrhundert und die 1960er Jahre.
Die Renaissancezeit
1579 wurde das Schloss von der Familie von Saldern errichtet, eine der einflussreichsten Adelsfamilien im Fürstenbistum Hildesheim und im Herzogtum Braunschweig. Ihr Stammsitz lag in Salzgitter-Saldern, gehörte zu Braunschweig. Das Stammschloss sieht dem Henneckenröder Schloss sehr ähnlich.1597 wurde die Kirche erbaut, ohne Kirchtur
Wer waren die Herren oder Ritter von Saldern? |
Den Renaissance-Stil erkennt man an der Dekoration des rechten und des linken Giebels mit Obelisken und Schnecken sowie an den Seiten-Risaliten (Vorsprüngen) mit den versetzten Quadern. Außerdem gibt es einen – heute eher verdeckten – geschmückten Erker an der Nordseite des Schlosses. Innen ist der Baustil noch erkennbar an den beiden Rundbogen-Türen im Erdgeschoss.
Die Barockzeit
1685 erwarb Graf Adam Arnold von Bocholtz die Schlossanlage und ließ die Wirtschaftsgebäude und das Gutshaus errichten. Als Drost des Amtes Wohldenberg wirkte er als eine Art adliger Landrat, der für diesen Bezirk den Landesherrn polizeilich, gerichtlich und administrativ vertrat.
| Wer waren die Grafen von Bocholtz? Da der Adel im Stift Hildesheim im 17. Jahrhundert fast ohne Ausnahme lutherisch geworden war, fehlten den Fürstbischöfen katholische Adlige, denen sie die Verwaltung des Stifts übertragen konnten. Die Fürstbischöfe holten sich deshalb Mitglieder des katholischen Adels aus Westfalen an ihren Hof und übertrugen ihnen wichtige Ämter. Zu diesen gehörte auch die Familie von Bocholtz. |
Im 18. Jahrhundert wurde das Schloss 1733 außen auf der Hofseite (= die repräsentative Schauseite) und innen modernisiert. Der Mittelgiebel wurde barockisiert, das Eingangsportal verändert und die beiden kleinen eingeschossigen Seitenflügel angebracht. Ornamente gibt es nur zum Hof hin (Schauseite), nicht zum Garten hin. Die Gartenseite blieb rustikal und ohne Ornamente (erkennbar auf einem Gemälde aus dem 18. Jahrhundert). Innen sind noch die barocke Freitreppe erhalten und zwei barocke Türen mit üppigem floralem Schmuck. 1711 wurde die Kirche auf Druck des Grafen von Bocholtz katholisch.
Das Schloss als Kinderheim
1820 kaufte Friedrich Blum die Schlossanlage nebst Ländereien vom Grafen von Bocholtz, dem ehemaligen Zeremonienmeister am Königshof Westphalen in Kassel.
| Wer war Friedrich Blum? Friedrich Blum war Landrentmeister - ein hoher Finanzbeamter - in Hildesheim. In den Wirren seiner Zeit (1802 fällt das Fürstbistum Hildesheim an das Königreich Preußen, 1807-13 gehört es zum französischen Königreich Westphalen, 1813 kommt es zum Königreich Hannover) schaffte er es - ein Bürgerlicher, kein Adliger - privat ein Vermögen aufzubauen und das Schloss Henneckenrode vom wohl hochverschuldeten Grafen von Bocholtz zu übernehmen. |
Das Schloss war sein Altersruhesitz. 1832 starb Friedrich Blum unverheiratet und ohne Kinder. Er wurde auf dem Friedhof in Henneckenrode beerdigt. In seinem Testament hat er dem Hildesheimer Bischof seinen Besitz angeboten, wenn der damit ein katholisches Waisenhaus für Kinder aus dem Fürstentum (nicht aus der Stadt Hildesheim) und dem Eichsfeld einrichtet. Außerdem musste der Bischof zusagen, den Kindern aus dem Heim und dem Dorf eine Schulbildung zu ermöglichen. Sie sollten „Unterricht im Lesen, Schreiben und Rechnen, nicht nur im Cathechismus ertheilt bekommen“ so Blum in seinem Testament.Der Bischof nahm die Erbschaft an und ca. 1835 wurde die Blum‘sche Waisenhausstiftung gegründet. Ihr gehören die Schlossanlage nebst Gutshof und Ländereien. 1838 wurden das Waisenhaus im Schloss eröffnet und die ersten Kinder aufgenommen.
Friedrich Blum hat damit die Entwicklung von Henneckenrode für die nächsten 190 Jahre wesentlich geprägt. Henneckenrode war damit wohl das einzige Kinderheim im Bistum Hildesheim, das direkt dem Bischof unterstand und vom Generalvikariat verwaltet wurde.
1838 wurde das Waisenhaus im Schloss eröffnet. Ordensfrauen der Vinzentinerinnen leiteten das Kinderheim (mit Unterbrechung) bis 1942.
1906 wurde die (Alte) Schule gebaut.
1942 wurde das Schloss zum Lazarett umfunktioniert, das Kinderheim aufgelöst.
Aufbruch in den 1960er Jahren
1946 wurde das Waisenhaus wieder eröffnet unter der Leitung der Armen Schwestern des Hl. Franziskus. Sie führten das Kinderheim bis 1997.
Anfang der 60er Jahre erfolgte eine Neuausrichtung der Blum'schen Waisenhausstiftung. Das Schloss, die Kirche, der Gutshof und die zur Stiftung gehörenden Wohnhäuser im Dorf wurden - äußerlich gut sichtbar - saniert und modernisiert, 1964 segnete der Hildesheimer Bischof Heinrich Maria Janssen die modernisierten Gebäude und weihte sie im Rahmen einer großen Feier ein. Um der Bedeutung dieser Maßnahmen Symbolkraft zu verleihen, überreichte er zwei Reliquien vom Hl. Wendelin aus dem Saarland, dem Schutzpatron der Bauern. Eine dieser Reliquien befindet sich in der Kirche St. Josef in Henneckenrode, die andere seit 2018 in der Kirche in Detfurth.
Aufgabe des Schlosses als Kinderheim
1997 gaben die Armen Schwestern des Hl. Franziskus die Leitung des Kinderheims ab, das Kinderheim wurde der Caritas Hildesheim übergeben. 2007 wurde die Schule in Henneckenrode geschlossen und in eine Tageseinrichtung für Senior*innen umgebaut. 2011 übernahm die Stiftung Katholische Kinder- und Jugendhilfe (eine Einrichtung der Caritas) die Trägerschaft der Kinder- und Jugendhilfe Henneckenrode.
2014 wurde bekanntgegeben, dass das Schloss als Kinderheim in Henneckenrode aufgegeben wird. Seit 2020 steht das Gebäude leer.
In der alten Schule wird weiterhin eine Tagesgruppe der Kinder- und Jugendhilfe geführt.
Seit der Aufgabe des Schlosses als Kinderheim wird nach einer neuen, sozial-ökologisch ausgerichteten Nutzung für das Schloss gesucht bzw. daran gearbeitet:
2021 gründeten mehrere interessierte Menschen den Verein GEWISS e.V. mit dem Ziel, ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt im Schloss zu realisieren, einen Ort der Begegnung zu schaffen und einen Beitrag für ein lebendiges und liebenswertes Dorfleben zu leisten.
Die Idee fand viel Zuspruch und zusammen mit der Bauabteilung des Bistums Hildesheim fanden mehrere Workshops statt, um Interessen abzugleichen und gemeinsame Zielvorstellungen zu entwickeln.
Wie es weiterging und was seitdem passiert ist, kann nachgelesen werden unter "Wie alles begann" ...